
interaktive Lerneinheit aus dem Selbstlernprogramm für Klasse 10
Entwicklung zum Erwachsenen, Fortpflanzung, Vererbung

 |
interaktive Lerneinheit aus dem Selbstlernprogramm für Klasse 10Entwicklung zum Erwachsenen, Fortpflanzung, Vererbung |
 |
|---|
|
|
© 2000-2007 Hans-Dieter Mallig |
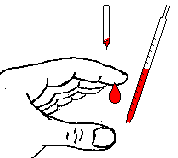 Gewinnung der Zellen: Menschliche
Chromosomen kann man z.B. aus den weißen Blutkörperchen gewinnen,
entsprechend präparieren und übersichtlich darstellen. Hierzu
brauchen wir natürlich Blut. Das können wir erhalten, indem wir
eine Fingerkuppe, nachdem wir sie mit einem Alkoholtupfer gereinigt haben,
mit einer sterilen Hämostylette anstechen. Der austretende Blutstropfen
wird mit einer Pipette aufgesaugt. Die Spitze der Pipette sollte man zuvor
in eine Heparinlösung tauchen, da das Heparin die Calciumionen aus
dem Blut bindet und so die Gerinnung des Blutes verhindert.
Gewinnung der Zellen: Menschliche
Chromosomen kann man z.B. aus den weißen Blutkörperchen gewinnen,
entsprechend präparieren und übersichtlich darstellen. Hierzu
brauchen wir natürlich Blut. Das können wir erhalten, indem wir
eine Fingerkuppe, nachdem wir sie mit einem Alkoholtupfer gereinigt haben,
mit einer sterilen Hämostylette anstechen. Der austretende Blutstropfen
wird mit einer Pipette aufgesaugt. Die Spitze der Pipette sollte man zuvor
in eine Heparinlösung tauchen, da das Heparin die Calciumionen aus
dem Blut bindet und so die Gerinnung des Blutes verhindert.
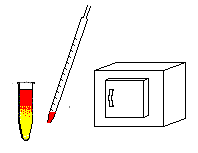 Ansetzen der Gewebekultur:
Das isolierte Blut wird unter sterilen Bedingungen in etwa 5 ml Kulturmedium
in ein Zentrifugenglas gebracht. Das Kulturmedium enthält Salze, Glucose,
Aminosäuren, Nukleotide, fetales Kälberserum, Heparin zur Verhinderung
von Gerinnung, Antibiotika zur Verhinderung von Infektionen und Phythämagglutinin.
Diese Kultur wird für ca. 3 Tage im Brutschrank bei 37°C bebrütet.
Unter dem Einfluß des Phythämagglutinins beginnen die kernhaltigen
Lymphozyten zu quellen und führen Mitosen durch. Die kernlosen Erythrozyten
bleiben unverändert.
Ansetzen der Gewebekultur:
Das isolierte Blut wird unter sterilen Bedingungen in etwa 5 ml Kulturmedium
in ein Zentrifugenglas gebracht. Das Kulturmedium enthält Salze, Glucose,
Aminosäuren, Nukleotide, fetales Kälberserum, Heparin zur Verhinderung
von Gerinnung, Antibiotika zur Verhinderung von Infektionen und Phythämagglutinin.
Diese Kultur wird für ca. 3 Tage im Brutschrank bei 37°C bebrütet.
Unter dem Einfluß des Phythämagglutinins beginnen die kernhaltigen
Lymphozyten zu quellen und führen Mitosen durch. Die kernlosen Erythrozyten
bleiben unverändert.
![]() Was
ist der Sinn vom Bebrüten dieser Zellkultur?
Was
ist der Sinn vom Bebrüten dieser Zellkultur? 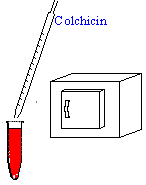
Stoppen der Mitosen: Der Kultur wird Colchicin, das Gift der Herbstzeitlose (Colchicum autumnale), zugesetzt und sie wird weitere 3 Stunden im Wärmeschrank aufbewahrt. Das Colchicin hemmt die Ausbildung des Spindelfaserapparates und folglich häufen sich jetzt Metaphasestadien der sich teilenden Lymphozyten an.
Trennung der Lymphozyten von den roten Blutkörperchen: Zunächst wird die Kultur 5 Minuten zentrifugiert. Dabei setzen sich die Blutkörperchen ab. Der Überstand wird anschließend abgesaugt und verworfen. Jetzt wird eine bestimmte Menge destilliertes Wasser dazu gegeben, das von den Blutzellen osmotisch aufgenommen wird. Dabei quellen die Zellen. Die roten Blutkörperchen platzen

dadurch, die weißen bleiben im gequollenen Zustand. Erneutes Zentrifugieren läßt die weißen Blutkörperchen Sedimentieren und die Reste der roten Blutkörperchen im Überstand. Dieser wird bis auf einen kleinen Rest abgesaugt. Dem Rest gibt man zum Fixieren vorsichtig ein Gemisch aus Methanol und Eisessig (3:1) dazu.
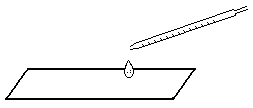 Verteilung der Chromosomen:
Aus einer feinen Pipette läßt man Tropfen mit einzelnen weißen
Blutkörperchen auf einen Objektträger mit einem Wasserfilm fallen.
Beim Aufprall des Tropfens platzt die Zelle und die Chromosomen breiten
sich nebeneinander aus. Zur Fixierung der ausgebreiteten Chromosomen wird
der Objektträger kurz durch eine Bunsenbrennerflamme gezogen und getrocknet.
Verteilung der Chromosomen:
Aus einer feinen Pipette läßt man Tropfen mit einzelnen weißen
Blutkörperchen auf einen Objektträger mit einem Wasserfilm fallen.
Beim Aufprall des Tropfens platzt die Zelle und die Chromosomen breiten
sich nebeneinander aus. Zur Fixierung der ausgebreiteten Chromosomen wird
der Objektträger kurz durch eine Bunsenbrennerflamme gezogen und getrocknet.
Färben: Etwa 15 Minuten dauert die Färbung in verdünnter Giemsa-Lösung. Danach wird der Objektträger in zwei weiteren Küvetten kurz gewässert und anschließend getrocknet. Danach kann mikroskopiert werden.
![]() Überlege,
in welche Abschnitte man die Herstellung von einem Karyogramm gliedern
kann und was für den jeweiligen Abschnitt wichtig ist.
Überlege,
in welche Abschnitte man die Herstellung von einem Karyogramm gliedern
kann und was für den jeweiligen Abschnitt wichtig ist.
| Mikroskopieren
und Fotographieren: Die Chromosomen, die offensichtlich aus einer Zelle
Stammen, werden gesucht und bei einer Vergrößerung von ca. 800-fach
mikroskopiert und fotographiert.
Sortieren zu einem Karyogramm: Von dem fotographierten Negativ wird eine Postiv-Vergrößerung im Format von mindestens 13x18 cm hergestellt. Aus dieser Vergrößerung schneidet man die einzelnen Chromosomen aus und sortiert sie nach Größe, Lage der Spindelfaseransatzstelle (des Zentromers) und je nach Färbemethode auch nach der Musterung. |

von stoch. uni-passau: Metaphasechromosomen |
|
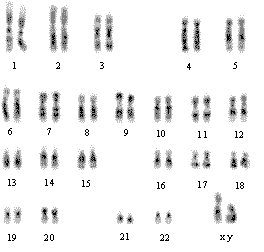
verändert nach stoch. uni-passau: Metaphasechromosomen sortiert |
Das nebenstehende Karyogramm ist übrigens nicht, wie oben beschrieben, mit Schere und Kleber sortiert worden, sondern von einem Automaten. Und hier kannst du selbst am Bildschirm
|
Vergleiche die beiden folgenden Karyogramme.
|
|
(Kopiervorlage für Folie oder Arbeitsblatt mit weiblichem und männlichem Karyotyp.)
![]() Welchen
Unterschied findest du?
Welchen
Unterschied findest du?
Man beschreibt den Karyotyp mit Hilfe einer Formel, in der zuerst
die gesamte Anzahl der Chromosomen (Autosomen und Gonosomen) genannt
wird und dann die Geschlechtschromosomen (Gonosomen) einzeln aufgeführt
werden. Der Karyotyp der Frau oben ist demnach: (46,xx).
![]() Welchen
Karyotyp hat der Mann im oberen rechten Karyogramm?
Welchen
Karyotyp hat der Mann im oberen rechten Karyogramm?
| Hast du gut gelernt, kannst du dein Wissen mit dem |
|
Trainer | oder mit dem |
| Weitere
Selbstlernmaterialien auf der Homepage- Startseite |
 |
 |
 |
 |
 |
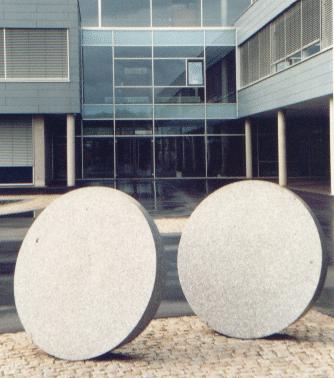 |